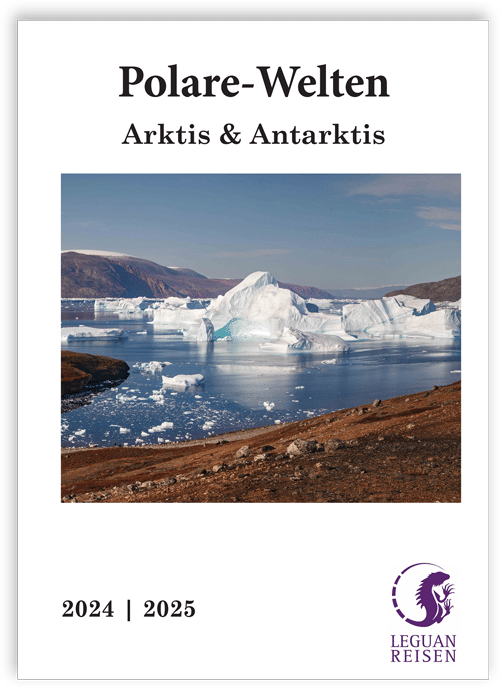Diesmal etwas Ernsthaftes: Künftig dürfen Ausländer in Spitzbergen praktisch nicht mehr wählen. Warum das traurig und beunruhigend ist.
Longyearbyen war bislang ein Örtchen, wie man es nur selten bis gar nicht auf der Welt findet. Gelegen auf 78 Grad Nord, in der Arktis, verwaltet von Norwegen, rechtlich geregelt durch den Spitzbergenvertrag. Wer in Longyearbyen wohnte, musste arbeiten und fit sein, wegen mangelnder gesundheitlicher Versorgung (es gibt nur ein kleines Krankenhaus und natürlich kein Pflegeheim) musste, wer alt oder krank war, gehen. Die Leute kamen von überall her, auch wegen der einfachen Visums-Formalitäten.
Wer drei Jahre hier war, durfte wählen und gewählt werden.
Einst waren beinahe alle gleich in Spitzbergen, egal, woher sie kamen.
Seit einigen Jahren aber nun rumpelte es immer mehr. Ausländern wurde es immer schwerer gemacht, Betriebe zu eröffnen oder ihre Betriebe zu erhalten. Die norwegische Bank schloss ihre Filiale – man kann nun in Longyearbyen kein Geld mehr abheben. Für Touristen macht das nichts, denn man kann überall mit Karte bezahlen. Für Ausländer, die dort wohnen, macht es alles kompliziert, weil man ein Bankkonto braucht, das man aber nicht mehr eröffnen kann und dergleichen. Auch bei den derzeit diskutierten Änderungen im Tourismus drängt sich der Eindruck auf, dass der motorisierte Land-Wintertourismus der meist norwegischen Gäste anders gehandhabt wird als der Schiffstourismus der meist nicht-norwegischen Gäste und es in Wahrheit gar nicht um Naturschutz geht.
Und nun das. Nach der neuen Regelung ist es für Ausländer nur dann möglich, das Stimmrecht in Longyearbyen zu erhalten, wenn sie vorher drei Jahre lang Norwegen selbst gelebt haben. Das ist natürlich bei den meisten Ausländern nicht der Fall – sie sind nach Spitzbergen gekommen, weil sie nach Spitzbergen wollten.
Warum wurde das so entschieden? Man konnte bisher nicht davon sprechen, dass die Verwaltung Longyearbyens von Ausländern dominiert war: Gerade mal ein Mitglied des Lokalstyre war kein norwegischer Staatsbürger.
Die norwegische Justizministerin Emilie Enger Mehl (Senterpartiet) hat ihre Entscheidung so begründet: Der Aufenthalt in Festland-Norwegen sei zwingend, um ein Verständnis für die Rahmenbedingungen der norwegischen Spitzbergenpolitik zu gewinnen. Und weil Norwegen mit Steuermittel vom Festland auch Infrastruktur auf Spitzbergen finanziert, müsse man zuvor also auch etwas in Norwegen beigetragen haben. Diese Argumentation allerdings hat so viele Löcher wie ein Eisberg Luftblasen hat: Denn Longyearbyen Lokalstyre hat nur lokal begrenzte Macht, die Inselgruppe untersteht ansonsten direkt der Regierung, die von allen Norwegern gewählt wird.
Die Entscheidung schafft sehr viel Unfrieden, gibt es doch jetzt Menschen, die seit zehn Jahren und mehr in Longyearbyen leben, aber nicht mehr wählen dürfen. Es entsteht in dieser einst so freien und gleichen Gemeinschaft, die sich an diesem Außenposten auch durch ihren Zusammenhalt so gut durchsetzte, auf einmal eine ganz ungute Ungleichheit, ausgelöst durch nationalistisch motivierte Handlungen. Ausländer, so scheint es, werden mehr und mehr unerwünscht, noch einmal soll es den Norwegern wohl nicht so gehen wie in den 1920er Jahren, als Franz Joseph Land auf einmal russisch wurde, wofür damals einige gehisste Flaggen reichten.
Die Motivation ist hier dieselbe, die Angst ist irrational. Es war nicht damit zu rechnen, dass China plötzlich 500 Menschen in Longyearbyen ansiedelt, die nach drei Jahren nur sich selber wählen würden.
Der Eindruck drängt sich auf, dass Spitzbergen so norwegisch sein soll wie nur möglich, Ausländer sollen soweit es geht zurückgedrängt werden, weil nördlich von Spitzbergen natürlich auch noch Ressourcen schlummern, und man Jahr für Jahr früher weit aufs offene Meer hinausblicken kann, weil das Eis verschwindet. Und diese Ressourcen sollen norwegisch sein. Auch von Sicherheitsinteressen war in der Vergangenheit die Rede, genauer definiert wurden diese jedoch nie.
Der Vorgang stimmt traurig und nachdenklich, und er macht eigentlich fassungslos. In einem demokratischen Land werden Menschen von ihrer Teilhabe ausgeschlossen, ohne wirklich fassbare Gründe – und der große Protest der Einwohner, übrigens auch vieler Norweger, wird ignoriert. Es gibt mittlerweile sogar eine Facebook-Gruppe, mit Namen: Spitsbergen Association of Unwanted Foreigners. Sie hat mehr als 200 Mitglieder.
Wenn ich an Spitzbergen denke, denke ich mittlerweile viel an diese Dinge. Wie alles immer schwieriger gemacht wird. Und dann denke ich an Schottland, wo uns die Menschen mit solcher Freundlichkeit begrüßt haben, an den Piers, wie sie sich ehrlich gefreut haben, ein ausländisches Schiff zu sehen und willkommen zu heißen, wie sie uns Fisch angeboten und uns auf schöne Plätze hingewiesen haben – und das an sehr vielen Orten des Landes. Und dann denke ich persönlich langsam: Anderswo ist es auch schön. Und je schwieriger es in Spitzbergen wird, umso einfacher wird es im Vergleich in Grönland. Zum Beispiel. Man kann gespannt sein, wie das alles weiter geht. Besser scheint es nicht zu werden.
Bis in zwei Wochen!
Eure
Birgit Lutz